Kambodscha: Zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit (Teil 1)
Categories Große Asienreise, Kambodscha
Mein Lonely Planet-Reiseführer und diverse Reiseblogs weisen ausdrücklich darauf hin: Sei beim Grenzübertritt von Thailand nach Kambodscha auf die hinterhältigsten Betrüger und die frechsten Grenzbeamten gefasst! Diese Grenze ist nun nicht meine erste und durch die letzten Erfahrungen hat sich beim Reisen über Landesgrenzen ein bisschen Routine eingeschlichen. Bislang lief alles super. An keiner Grenze hatte ich Probleme mit Grenzbeamten. Dennoch: Ein wenig aufgeregt bin ich wegen der zahlreichen warnenden Hinweise schon. Die Grenze zwischen Thailand ist zwar kein Abenteuer wie vielleicht die zwischen China und Nordkorea. Letztendlich sitzen die Grenzbeamten doch am längeren Hebel. Und wer nicht bereit ist, die geforderten Schmiergelder zu zahlen, wird nicht durchgelassen.
Auf der thailändischen Seite entgehe ich den Schleppern, die angeblich erforderliche medizinische Zeugnisse für das kambodschanische Visum ausstellen. Ich entgehe auch denen, die meinen, schon auf thailändischer Seite das kambodschanische Visum ausstellen zu können. Stattdessen verfange ich mich in der Schlange der thailändischen Immigration. Warten. Ich bin nicht der Einzige, der über die Grenze möchte. Stück für Stück geht es voran. Nach ca. 45 Minuten wird der thailändische Ausreisestempel in meinen Pass gedrückt. Die thailändischen Visabestimmungen sind sehr transparent, daher würde kein thailändischer Grenzbeamte Schmiergelder verlangen.
Weniger transparent sind die Bestimmungen und Gebühren in Kambodscha. Wieviel das Visum kostet hängt vom Grenzübergang und scheinbar von dessen Lage ab. „Teegelder“ für die entlegeneren Übergänge sind üblich und machen diese Visa teurer. Mein Grenzübergang ist der am meisten genutzte und mit vsl. 30 USD auch der günstigste. Ich laufe über die Grenze, fülle in einem am Straßenrand liegenden Zelt das Visaformular aus. Drumherum herrscht buntes Treiben. Vollbeladene Karren werden hin- und hergeschoben, viele Menschen laufen kreuz und quer. Ich komme mir vor wie auf einem Bazar – nicht wie in einem gesicherten Bereich eines Grenzübergangs. Mit meinem Zettel werde ich in ein Haus geschickt, in dem die Visa-on-arrival ausgestellt werden. In dem Raum thront ein Grenzbeamter, in einem weiteren Raum hinter einer Glasscheibe sitzen und stehen ca. sieben weitere Beamte um einen großen Schreibtisch herum und sind mit anderen Sachen beschäftigt als mit ihrer originären Arbeit. Als ich versuche die Beamten hinter der Glasscheibe auf mein Visaverlangen aufmerksam zu machen, tritt der thronende Beamte an mich heran und sagt in einem bestimmenden Ton, ich solle 30 USD und 100 Baht (ca. 2,50 EUR) zahlen. Ich entgegne, dass ich die 30 USD zahle, nicht jedoch die 100 Baht. Ich versuche erneut die Aufmerksamkeit der hinter der Glasscheibe sitzenden Beamten zu erhaschen, doch der thronende Beamte schreit mich an, ich solle mich hinsetzen. Bisher läuft alles nach Plan – genauso steht es auch in meinem Reiseführer bzw. in den Reiseblogs. Nach ein paar Minuten versuche ich es erneut, reiche durch die Öffnung in der Fensterscheibe meinen Reisepass, der Beamte dahinter befiehlt mir, ihm die 30 USD zu geben. Ich jedoch entgegne ihm, dass ich erst mein Visum im Pass sehen möchte, dann bezahle ich. Mir ist schlichtweg das Risiko zu hoch, dass die Beamten das Geld einstecken und im Nachhinein behaupten, ich hätte nicht gezahlt. Das jedoch gefällt dem Beamten gar nicht und er schreit mich an, dass ich zurück (nach Thailand) gehen solle. Da ist sie nun – die Zwickmühle. Der Beamte sitzt am längeren Hebel. Mir bleibt nichts anderes übrig als seiner Anweisung zu folgen. Ich reiche ihm die 30 USD durch die Fensterscheibe und setze mich. Nach ca. fünf Minuten werde ich aufgerufen und mein Reisepass wird auf den Tisch fast in eine Wasserlache geworfen. Schon allein das finde ich ist ein Unding, denn letztendlich ist ein deutscher Reisepass ein Dokument, für das viele Menschen ihr Leben riskieren. Immerhin habe ich mein Visum im Pass – für die offiziellen 30 USD. Mit einem Grummeln im Bauch verlasse ich das Haus. Hätten die Erfahrungen meiner Vorreisenden mich nicht schon auf diese Abläufe hingewiesen, wäre ich wahrscheinlich in einem anderen emotionalen Zustand aus dem Gebäude gekommen.
Diese Erlebnisse sind äußerst tragisch, denn sie geschehen in gleicher oder ähnlicher Form an vielen kambodschanischen Grenzübergängen – bei der Ein- und Ausreise, wie mir andere Reisende berichten. Dieser eine negative Vorfall macht damit die vielen schönen Momente, die man in dem Land haben kann, zunichte.
Nun aber: Willkommen in Kambodscha! Für meinen ca. zweieinhalbwöchigen Aufenthalt habe ich einen Mix aus Orten mit kultureller Bedeutung, Großstadtleben, maritimem Flair, Wildnis und Landleben herausgesucht. Kambodscha ist recht überschaubar – daher müsste ich diese Route in einer vergleichsweise kurzen Zeit schaffen.
Nach dem kulturellen Einstieg mit den weltbekannten Tempelanlagen um Angkor Wat bei Siem Reap fahre ich in die kambodschanische Provinz um Battambang. Naturschönheiten kommen derzeit kaum zum Vorschein. Auch wenn die Regenzeit vor einigen Tagen begonnen hat, zeigt sich mein Umfeld weiterhin trostlos: karg, flach und trocken. Erst beim langsamen Erradeln von Battambang und dessen Umgebung lerne ich das richtige kambodschanische Leben kennen und schätzen: Straßen werden gesäumt von Ständen, die z.B. Mangos, Benzin in Fantaflaschen oder andere Lebensmittel verkaufen. Kinder in Schuluniformen auf übergroßen Fahrrädern radeln von der Schule nach Hause. Ganze Familien sind auf einem Moped unterwegs. Am Straßenrand stehen Menschen und unterhalten sich. Kurzum: Der öffentliche Raum wirkt belebt. Sehr auffallend ist jedoch: Ständig höre ich links, rechts – überall – ein „Hello“. Ich ziehe die Aufmerksamkeit der Kinder auf mich. Noch bevor ich sie sehe, sehen sie mich. So kommt es vor, dass ich häufig ein „Hello“ höre, aber kein Kind sehe. Erst wenn ich mich dann genauer umschaue, sehe ich ein Kind auf einem Sandberg oder auf der Terrasse eines Hauses, etc. Sie winken mir zu. Ab und zu werde ich dann nach meinem Namen gefragt und wenn ich dann die Gegenfrage stelle, schauen mich die Kinder verlegen an und rennen weg. So viele „Hello“ wie in diesen Tagen habe ich noch nie gehört.
Auf meinen weiteren Wegen durch Kambodscha komme ich an vielen sog. „Killing Fields“ – Orten, vergleichbar mit Konzentrationslagern – vorbei. Wer durch Kambodscha reist, der kommt früher oder später mit der Geschichte des Landes in Berührung, die so menschenverachtend ist wie kaum eine andere – und dazu fast bis in die Gegenwart reicht.
Die Kambodschaner bzw. die Khmer (so heißt das Volk, das in Kambodscha lebt), hatten oft das Pech in Konflikte, die zwischen anderen Ländern ausgetragen wurden, hineingezogen zu werden. So auch in den Vietnamkrieg in den 1960ern, in dem Südvietnam mit den verbündeten USA gegen das kommunistische Nordvietnam kämpfte. Mit der Erlaubnis des kambodschanischen Königs bezogen die kommunistischen Vietnamesen Stellung und bekämpften vom kambodschanischen Staatsgebiet die Südvietnamesen. Im Gegenzug bombardierten die USA das östliche Kambodscha und die Stellungen der Kommunisten. Die arme Bevölkerung in den ländlichen Gebieten suchte Zuflucht in dem vergleichsweise sicheren Phnom Penh. Korruption im Verwaltungsapparat und im Kreis der Königsfamilie führten zur Absetzung des Königs, doch auch die nachfolgende Regierung gab kein besseres Bild ab. Folglich hatte die Bevölkerung die Herrschaft anderer Mächte und die korrupte „Elite“ satt. In dieser labilen Situation überrannten Rebellen – die sog. „Khmer Rouge“ – innerhalb weniger Monate halb Kambodscha und initiierten unter ihrem Führer Pol Pot eine Revolution. Nach Pol Pots Vorstellungen sollte Kambodscha in eine reine Agrarwirtschaft umgewandelt werden, die sich vorwiegend dem Reisanbau widmet.
Als die Khmer Rouge im April 1975 an die Macht kamen, wurde die Bevölkerung in den Städten gezwungen, in die ländlichen Regionen überzusiedeln und als Sklaven 12 bis 15 Stunden am Tag zu arbeiten. Unter dem Vorwand, dass eine Bombardierung der USA ansteht, wurde die Bevölkerung Phnom Penhs innerhalb von zwei Tagen evakuiert und die Stadt von 2 Millionen auf 50.000 Einwohner reduziert. Wer sich den Befehlen der Khmer Rouge widersetzte wurde auf der Stelle exekutiert. Pol Pot ließ zudem alle Personen, von denen Kritik an seiner Revolution zu erwarten wäre, töten. Schauplatz dieser Tragödien waren meist die Killing Fields. Zu dem Kreis der Gebildeten gehörten Ingenieure, Lehrer, Ärzte – und deren komplette Familien. Ein Vorgehen, dass mich sehr stark an das der Pakistaner in Ostpakistan, heute Bangladesch, erinnert (mehr zu der Geschichte Bangladeschs in meinem Beitrag „Bangladesch – unglaublich, aber wahr“).
Die Art und Weise, wie Khmer ihre Landsleute auf den Killing Fields und anderen Orten des Landes um ihre Leben brachten, sucht seinesgleichen. Weil Munition zum Erschießen zu teuer war, wurden die Gefangenen mit den Werkzeugen der Bauern gequält und getötet. Um die Dimensionen der Foltermethoden zu umreißen, reicht zu erwähnen, dass den Gefangenen die Kehlen entfernt wurden, damit sie bei der weiteren Folter nicht mehr schreien können.
Auch das „normale“ Bauernleben war durch und durch von der Ideologie der Khmer Rouge durchzogen. Massenzwangsheiraten waren an der Tagesordnung: Nach einem anstrengenden Arbeitstag auf dem Reisfeld wurden in Dörfern bis zu 100, sich meist nicht bekannte Frauen und Männer zusammengetrieben, vermählt und anschließend in ausgewählte Häuser geschickt, um ihrer Ehepflicht nachzugehen. Pol Pot brauchte für seine Vision des Bauernstaates eine Heerschar an Nachwuchs. Deshalb wurde penibel darauf geachtet, dass die Vermählten sofort ihrer Sache nachgingen – wenn nicht, wurden sie hingerichtet.
Ende 1978 brachte eine Invasion der Vietnamesen die Herrschaft der Khmer Rouge zu Fall. Während der fast vierjährigen Herrschaft der Khmer Rouge wurde etwa ein Viertel Kambodschas Bevölkerung (2 von 8 Millionen) ausgelöscht. Doch mit den Gräueltaten war lange nicht Schluss: Um die Khmer Rouge vor dem Fliehen zu hindern, wurde der westliche Landesteil vom Golf von Thailand bis Laos komplett vermint – eine Tatsache, mit der Kambodscha heue täglich zu kämpfen hat. Die Führer der Khmer Rouge schafften es auch in den folgenden Jahrzehnten durch Bündnisse mit anderen Parteien an der Macht zu bleiben. Interessanterweise unterstützten auch einige Parteien in westlichen Ländern, wie z.B. die Sozialisten in Schweden, die Khmer Rouge. Erst mit dem natürlichen Tod von Pol Pot im Jahr 1998 fielen die letzten Dynastien im Norden Kambodschas.
Die Geschichte der Khmer Rouge ist bis heute nicht vollständig aufgearbeitet. Das merke ich vor allem daran, dass die wichtigsten Orte zur Darstellung der Herrschaft (Tuol Sleng Museum „S-21“ und Killing Fields in Phnom Penh) keineswegs vollständig die Hintergründe darstellen. Viele Fragen bleiben offen: Wie kam es genau dazu, dass die Khmer Rouge an die Macht kamen? Wie konnten kurzerhand so viele Soldaten – meist im Teenageralter – rekrutiert und zu solcher Brutalität erzogen werden? Offensichtlich ist auch, dass die Führer der Khmer Rouge teilweise mit der heutigen kommunistischen Führung Kambodschas verbunden ist – so stark, dass bis 2009 in Oberschulen der Genozid nicht unterrichtet wurde.
Im alltäglichen Leben sind die Folgen der Herrschaft deutlich zu spüren, auffallend ist z.B., dass es relativ wenig alte Menschen gibt oder, dass viele Menschen von einfachen Arbeiten leben, die keine Hochschulausbildung erfordern (die Bevölkerung mit höherer Bildung wurde ja ausgelöscht). Und schlichtweg merke ich es auch dabei, wenn der junge, kambodschanische Gesprächspartner sagt, keine Großeltern zu haben.
Nach den derzeit noch trockenen Landesteilen im Herzen Kambodschas verschlägt es mich in die südlichen, an das Meer angrenzenden Gebiete. Ergiebiger Niederschlag am Nachmittag ist hier sicher. Meine nachmittäglichen Erkundungstouren fallen somit regelmäßig ins Wasser. Glück habe ich mit einer Bio-Pfefferplantage in der Nähe von Kampot. Wegen günstiger klimatischer Verhältnisse gedeiht in der Region um Kampot ein besonders guter Pfeffer, der als „Kampotpfeffer“ weltbekannt ist.
Entlang der Küste fahre ich weiter in Richtung Nordwesten, mein Ziel: Die Cardamom Mountains, ein Gebirge, das großflächig von Regenwald bedeckt ist. Als ich in Koh Kong, dem Ausgangspunkt an der Küste ankomme, ziehen bereits dunkle Wolken auf. Keine 20 Minuten später regnet es wie aus Kübeln. Und das um 11 Uhr morgens – von wegen, dass es während des Monsuns nur nachmittags regnet. Das sind gänzlich schlechte Bedingungen, um in den Dschungel zu hitchhiken. Trotz des Regens arbeite ich mich zum Ortsausgang vor, um wenigstens ruhigen Gewissens im Regen zu warten und keine Mitfahrgelegenheit zu verpassen. Die Straße in den Dschungel ist schmal und sieht nicht sonderlich befahren aus. Ob hier heute überhaupt ein Fahrzeug vorbeikommt? Ich versuche mich bei den Einheimischen zu erkundigen, ob die Straße tatsächlich dahin führt, wo ich hin will. Doch meine Ziele kennen die Dorfbewohner nicht. Mir bleibt nichts anderes übrig als zu warten. Keine 15 Minuten später biegt ein Van um die Ecke, vollgestopft mit Reis, Trinkwasser und sonstigen Einkäufen. Die beiden Herren zeigen auf ein Schild, das den Weg zu einem Staudamm weist. 33 Kilometer. Ich weiß zwar nicht, ob dieser Staudamm auf meiner Strecke liegt, aber meine Motivation würde steigen, wenn ich vom Fleck kommen würde. Nach ein bisschen Verhandlung mit Händen und Füßen gelingt es mir die beiden Herren zu überzeugen, mich mitzunehmen.
Der extrem vollbeladene Van kämpft sich die Berghänge hoch – und runter. In einer Kurve patrouillieren bewaffnete Ranger, dass kein Holz und keine Tiere illegal aus dem Dschungel geschafft werden. Es regnet weiterhin – mal stark und mal stärker. Ich habe weiterhin keine Ahnung, ob ich auf dem richtigen Pfad bin. Abzweigungen oder weitere Hinweisschilder habe ich nicht gesehen – die Richtung wird stimmen. Nach etwa eineinhalb Stunden Fahrt erreichen wir eine Lichtung im Dickicht. Zu meiner Linken befinden sich ein paar Holzhütten. Die Herren geben mir zu verstehen, dass meine Fahrt hier endet. Ich richte mich darauf ein, in den Holzhäusern irgendwo einen Schlafplatz zu ergattern. Doch die Frauen, die unter dem Vordach Gemüse schnippeln rauben mir die Illusion, hier unterzukommen. Als gegen 16.30 Uhr der Regen nachlässt, wage ich mich auf der Straße etwas weiter, passiere eine Brücke und erreiche ein großes Areal mit neuen Häusern und einem Umspannwerk. Darüber prangen die Letter eines chinesischen Energieunternehmens. Ich könnte mir zwar einen schöneren Ort zum Übernachten vorstellen als das Betriebsgelände eines chinesischen Unternehmens, doch in der Not nehme ich auch das in Kauf. Ich klopfe an der Pforte an. Der junge, kambodschanische Pförtner macht mir ebenfalls keine Hoffnungen – der Vorgesetzte gibt nach Rücksprache kein grünes Licht. Und nun? Der Pförtner erkennt meine missliche Lage und telefoniert seine Freunde durch, ob irgendjemand die Straße in Kürze passiert. Fehlanzeige. So richtig kann er mir nicht weiterhelfen – er kennt sich hier auch nicht aus. Ich richte mich darauf ein, irgendwo zwischen dem nassen Bambus und den Lianen mein Schlafplatz einzurichten.
Nach etwa 45 Minuten kommt auf der nahegelegen Straße ein alter Pickup vorbeigeklappert. Der Pförtner stoppt diesen durch Winken. Ich habe Glück, bis nach O Soum, einem Ort, von dem ich schonmal gehört habe, jedoch nicht weiß, wo er liegt. Wir rattern los. Aus der Betonpiste wird – nachdem wir die chinesischen Anlagen hinter uns gelassen haben – eine Schlammpiste. Gleichzeitig fängt es wieder intensiv an zu schütten. Wir quetschen uns zu dritt in die Fahrerkabine. Das Fenster lässt sich nicht schließen. Auch wir werden nass. Wie gut, dass mein Rucksack, der auf der Ladefläche liegt, abgedeckt ist. Wir rutschen über die Schlammpisten. Es wird dunkel. Kurze Zeit später rollen wir wieder auf einer Betonpiste. Von einer Anhöhe kann ich im Regen schemenhaft die Großbaustelle eines Staudammes entdecken. Chinesische Unternehmen investieren hier massiv in Wasserkraftwerke. Erneut wechseln wir auf eine rote Schlammstraße. Links und rechts der Piste sind häufig nur noch die Stümmel von Baumstämmen zu erkennen. Hier war einmal Wald. Nach einer weiteren Stunde Fahrt durch die Dunkelheit tut sich uns gegenüber ein nackter Hang auf, auf dem hell erleuchtet meterhohe chinesische Schriftzeichen prangen. Weitere 5 Minuten später nähern wie uns einer riesigen Staumauer. Der Fahrer des Pickups hat Mühe, das Fahrzeug die rutschige Steigung neben der Staumauer hochzubringen. Ich habe keine Orientierung und weiß nicht, wo ich bin. Auf meiner virtuellen Erkundungstour auf google maps vor meiner Fahrt habe ich keine Staumauern gesehen. Wir passieren ein Dorf, fahren über eine mit Wasser gefüllte Schlaglöcherpiste und halten dann an einem Holzhäuschen.
Die Bewohner scheinen Freunde meiner Fahrer zu sein. Vor dem Hauseingang wachen zwei Ochsen. Ich werde zum Abendessen eingeladen und gefragt, ob ich die Nacht hier (neben den Ochsen) in der Hängematte unter dem Vordach verbringen möchte. Da ich überhaupt keine Ahnung habe, wo ich bin und eigentlich mit dem Ziel in die Cardamom Mountains gekommen bin, etwas zu sehen (und nicht in der Dunkelheit durchzurasen), Freunde ich mich mit der Hängematte an. Als ich meinen Rucksack von der Ladefläche des Pickups hole, merke ich, dass ich mich fälschlicherweise in Sicherheit wähnte – und meine Sachen doch nich trocken blieben. Das Wasser kam auf der Ladefläche von unten – Reisepass, Kleidung, Reiseführer sind teilweise durchgeweicht. Soweit möglich lege ich die Sachen zum Trocknen auf dem Tisch neben der Hängematte aus und gehe schlafen.
Irgendwann wache ich auf, ich meine, es wäre 4 Uhr morgens, doch der Blick auf die Uhr verrät mir, dass es erst 23.15 Uhr ist. In der ferne höre ich eine Kettensäge. Wer sägt denn mitten in der Nacht im Dschungel Holz? Ich versuche wieder zu schlafen, doch so recht gelingt mir das nicht. In der Ferne leuchtet es kurz auf, mit der Zeit immer häufiger. Es donnert – und dann fängt es wieder an zu regnen. Meine Hängematte wird nass. Ich fürchte um meine zum Trocknen ausgelegten Sachen, räume diese nach einigem Hin- und Herwälzen zusammen und lege mich auf die Holzbank neben dem Tisch, die noch unbequemer als die Hängematte ist.
Als es hell wird realisiere ich, wo ich bin: in einer Bananenplantage! Und meine Gastgeber sind die Besitzer. Nach dem Frühstück bringen sie mich in das Dörfchen O Soum, das keine 5 Kilometer von der Plantage liegt.
Fortsetzung dieses Beitrags folgt im zweiten Teil.
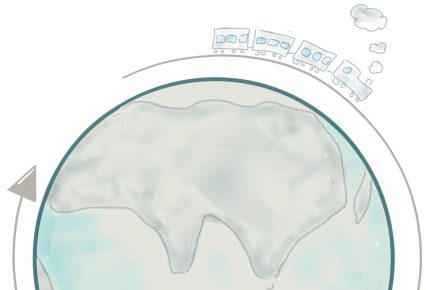























even the french translation is awefull, i like read your adventure.amazing and nice picts 😉
Very interesting subject, thanks for posting.Raise blog range