
Fortsetzung von Teil 1 und damit meiner Erkundungstour durch die Fabriken Bangladeschs:
Ziegelei
Meine nächste Fabrik stellt keine Exportprodukte her. Die Produkte sind für den heimischen Markt bestimmt: Ziegeln. Landauf und landab, ebenso in Indien, haben mich die rauchenden Schlote und deren Umgebung interessiert, sowie das, was die Frauen und Männer, die dort arbeiten, auf ihren Köpfen herumtragen.In Barisal fragen wir bei einer Ziegelei an und bekommen gefühlt die ganze Belegschaft für unsere Führung an die Seite gestellt. Vermutlich verzögert sich wegen uns die Produktion um eine halbe oder sogar um eine ganze Stunde.
Der Produktionsprozess ist relativ einfach: Vom Uferbereich des nahegelegenen Flusses wird Lehm geholt, dieser wird mit einem großen Quirl durchgearbeitet. Diese Masse wird in Förmchen gedrückt, dann ausgestülpt und für ein bis zwei Tage – je nach Sonneneinstrahlung – trocknen gelassen. In einem Oval, in dessen Mitte der Schornstein steht, werden die Ziegeln gebrannt – jedoch nur auf etwa 65% der Fläche des Ovals: Sukzessive werden getrocknete, noch nicht gebrannte Ziegeln so aufgeschichtet, dass dazwischen Hohlräume bleiben. Der Haufen wird mit einer weiteren Ziegelschicht und mit Erde abgedeckt. Weiter hinten in dieser „Ziegelschlange“ lodert das Feuer, am Ende der Schlange ist das Feuer erloschen und die gebrannten Ziegeln werden abgeschichtet. So läuft diese Ziegelschlange unentwegt im Kreis. Nach ca. 22 Tagen ist eine Runde geschafft. Oben auf dem Ofen stehen die Feuermeister und kippen in bestimmten Zeitintervallen Kohle von oben in die Hohlräume, um das Feuer am Leben zu halten. Auf dem Ofen ist es ziemlich heiß, dazu beißt der Rauch aus dem Verbrennungsprozess der Kohle. Wir halten es keine fünf Minuten auf dieser Hölle aus. Und wieder kommt der Gedanke auf, was für beschissene Jobs es geben kann. 10 Stunden und mehr bei dieser Hitze und den Emissionen zu arbeiten – das kann nicht gesund sein.
Shipbreaking
Der gefährlichste Job, den ich bei meiner Erkundungstour kennenlerne, ist der des Shipbreakers. Von jetzt auf gleich kann das Licht eines Shipbreaker ausgehen, mittel- und langfristig tut es das bei diesen Arbeitsbedingungen sowieso eher als bei gewöhnlichen Jobs. Um das beurteilen zu können muss keine Langzeitstudie durchgeführt werden. Es reicht der Besuch des Arbeitsplatzes.
Was ist Shipbreaking? An den Stränden etwa 10 bis 25 Kilometer nördlich von Chittagong werden Ozeanriesen, dessen Lebenszeit abgelaufen ist, zerlegt. Gearbeitet wird jedoch nicht in Trockendocks, sondern direkt an den Stränden, mit bloßen Händen, barfuß, mit Schneidbrennern und Seilwinden. Damit die Schiffe möglichst nah am Strand liegen, wird das zu zerlegende Schiff mit Volldampf auf das Festland zugesteuert. Die Satelliten-Aufnahmen auf Google maps veranschaulichen ganz gut die Dimensionen des Shipbreakings an den nördlichen Stränden Chittagongs.
Ganz im Gegensatz zu anderen Orten in Bangladesch werde ich an den Werkstoren ganz und gar nicht freundlich empfangen. No entry! Die Strände werden von drei bis fünf Meter hohen Mauern umfasst. Wo doch sonst in Bangladesch immer alles möglich ist, ist hier nichts möglich. Ich schlendere an mehreren Toren entlang, doch komme nicht auf die Gelände bzw. erhasche keinen Blick auf die Strände. Auch hier spielt sich vor den Werksmauern das ganz normale bengalische Leben ab. Ich laufe durch kleine Dörfer mit Tümpeln und vielen spielenden Kindern. Zu den Dorfbewohnern bin ich diesmal ganz besonders nett, auch zu denen, zu denen ich eigentlich nett sein will: Irgendjemand muss doch auf den Yards arbeiten und mir vielleicht Zutritt verschaffen können. Doch Fehlanzeige. Selbst ein junger Mann, dessen Onkel ein Betrieb gehört, meint, er dürfe nicht mit Kamera auf das Werksgelände. Zu groß sei die Sorge, dass die Arbeits- und Umweltbedingungen an die Öffentlichkeit gelangen, nachdem Umweltorganisationen vor einigen Jahren bereits einen großen Coup gelandet haben. Bei meinem Spaziergang bietet mir ein Dorfbewohner eine Bootsfahrt an. Auch wenn es mich reizt, die Szenerie von der anderen Seite, also vom Wasser aus, zu sehen, ist mir die ganze Aktion doch zu heikel. Außerdem können wir uns nicht auf einen Preis einigen und dunkel wird es auch schon.
Neuer Tag, neues Glück. Am zweiten Tag fahre ich gleich zu einer Mole, an der Schiffe zu einer nahegelegenen Insel an- und ablegen und von der ich, so meinte Newaz, einen ausgezeichneten Blick auf das Shipbreaking haben soll. Er hat recht.
Die Umgebung lässt sich kaum in Worten beschreiben: Auf den Schiffen, auch wenn sie bereits zur Hälfte zerlegt sind, wirken die Arbeiter wie kleine Männchen. Die Arbeiter waten durch den Schlamm und transportieren Dämmmatten ab. Große, abgetrennte Schiffsteile liegen im Wasser herum.
Nach etwa zwei Stunden habe ich von der Szenerie an der Mole genug und überlege, ob ich nicht doch an einer anderen Stelle direkt an das Gelände herankomme. Ich laufe, laufe und laufe. Irgendwo muss es doch eine zugängliche Stelle geben. An einem Yard sind die Shipbreaking-Arbeiten in vollem Gange. Als ich die Küstenlinie erreiche feiern die Arbeiter ihren Tageserfolg: Unter lautem Kreischen rauscht der rechte Teil des Bugs ins Wasser. Die Männer freuen sich. Und stehen ungesichert auf dem Schiff neben der Abruchkante, sowie im Wasser. Da die Shipbreaking-Industrie super schnell wächst (Stahl ist teuer und daher sehr begehrt), konnte an dieser Stelle noch keine Mauer gebaut werden. Ohne dass mich jemand daran hindert kann ich vom Ufer aus bei den Arbeiten zuschauen. Der Strand ist ölverschmiert, Asbestfetzen liegen überall verstreut. Ich frage, ob es keinen Schutz gegen den Asbest gäbe. Ein Mitarbeiter zieht aus seiner Tasche ein Läppchen, das vermutlich die Funktion eines Mundschutzes übernehmen soll, und meint, er könne besser ohne arbeiten.
Alles, was ein Schiff an Innen- und Außenleben hat wird an Ort und Stelle zerlegt, auf Lkw gepackt und auf den schmalen Staubwegen durch die Palmenhaine und durch die Dörfer abtransportiert. Etwas im Hinterland befinden sich Stahlhütten, wo die Schiffsteile eingeschmolzen werden. Was noch zu gebrauchen ist, wird entlang des Dhaka-Chittagong-Highways, der parallel in etwa zwei Kilometer Entfernung zur Küste verläuft, zum Verkauf angeboten. Wer also eine Schiffsleiter oder einen Tresen braucht, dem empfehle ich den Weg nach Chittagong. Ohne Witz, viele Kapitäne fahren nach Chittagong, um dort Ersatzteile für ihre Schiffe zu besorgen.
Mein persönliches Resume „Made in Bangladesh“
Zwei Gedanken schossen mir bei meinen Erkundungstouren unglaublich häufig durch den Kopf:
Erstens: Wie toll es ist, dass die Europäer sich so unglaublich hohe Sozial-, Umwelt- und Sicherheitsstandards erarbeitet haben (Ich könnte auch sagen: „Wie gut wir es in Deutschland haben.“ Doch der Satz macht es ein bisschen zu einfach.)
Zweitens: Wie traurig es ist, dass wir die Arbeiten, wo wir uns diese Standards nicht leisten wollen, bewusst auf andere Länder abwälzen.
Die Shipbreaking-Industrie war bis in die 70er Jahre vornehmlich in Deutschland, England und den USA angesiedelt. Vermutlich kein Reeder dieser Welt möchte bei den derzeit niedrigen Transportmargen sein Schiff teuer in Deutschland zerlegen lassen, sondern in Ländern wie Bangladesch, Pakistan und China. Beim Blick in den pechschwarzen Buriganga River, bei den im Chemiecocktaildunst arbeitenden Lederfabrikmitarbeitern oder bei den im Asbest rumlaufenden Shipbreaking-Arbeitern sah ich weniger ein Versagen der bengalischen Arbeits- und Umweltbehörden. Vielmehr dachte ich an die Wühltische in westlichen Kaufhäusern, wo Artikel für Ramschpreise (getreu dem Motto „Hauptsache billig“) verkauft werden. Gleichzeitig dachte ich an große Modeketten, die einen Großteil des Verkaufspreises für sich einstecken und denen, die die eigentliche Arbeit machen, nur einen Bruchteil abgeben. „Fair“ ist was anderes! In Bangladesch wird dieser Missstand besonders deutlich.
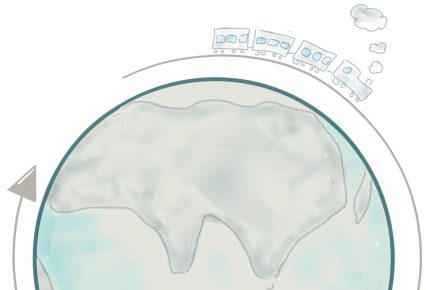






















I like this weblog it’s a master piece! Glad I found
this ohttps://69v.topn google.Raise blog range