
Als ich in Mumbai ankomme ist es schon relativ spät, ungefähr 22.30 Uhr. Während bei uns in Deutschland um diese Uhrzeit selbst in Großstädten meist die Randsteige hochgeklappt werden, herrscht hier ein buntes Treiben: Menschen, Menschen und noch mehr Menschen. Um zu meinem Gastgeber zu kommen, muss ich noch ein paar Stationen mit der S-Bahn fahren. Als ich die einfahrenden S-Bahnen sehe, traue ich meinen Augen nicht: Die Inder stürmen die noch nicht mal stehenden Züge, lassen nicht aussteigen, es herrscht ein Gedränge und Geschupse. Einerseits um die raren Sitzplätze, anderseits um die „Hängeplätze“ in den Türbereichen. Ja, die Menschen hängen in den offenen Türbereichen! Noch bevor der Zug steht ist der Fahrgastwechsel bereits vollzogen. Ich frage mich, wie ich das nun machen soll: Mit meinem Rucksack habe ich in dem Getümmel gar keine Chance. Doch ich habe Glück, meine S-Bahn ist nicht ganz so voll und ich komme trotz meines Gepäcks mit.
Bei meinen Erkundungstouren zeigt sich Mumbai genau so, wie ich es mir vorgestellt habe: alte, hohe Gebäude aus der Zeit Britisch-Indiens im Süden der Stadt, viele moderne Hochhäuser, Palmen gesäumte Straßen, eine etwas ruhigere Stadt, alte, rote, rumplige Busse, teilweise sogar doppelstöckig. Außerdem ist es warm und vermutlich wegen des angrenzenden Meeres kommt ein wenig Südseefeeling auf. Durch die Lage auf einer Halbinsel fühle ich mich häufig an Manhattan erinnert. Wesentlich auffälliger als in Dehli ist der Unterschied von arm und reich – und zwar von sehr arm und sehr reich. Mumbai haftet das Image an, dass man es hier von ganz unten nach ganz oben schaffen kann. So zieht Mumbai aus den ländlichen Gebieten Heerscharen von mittellosen Menschen an, die in der Großstadt ihr Glück suchen. Gleichzeitig leben in Mumbai die reichsten Inder des Landes, die zu ihrem Wohlstand z.B. durch die Filmindustrie oder den Finanzsektor gekommen sind. Auch wenn finanziell zwischen diesen beiden Extremen – arm und reich – Meilen liegen, sind sie doch eng miteinander verwoben: Die Slums grenzen direkt an die Gebiete mit modernen Hochhäusern. Auch ich stolpere, sobald ich den Fahrstuhl des Hochhauses meines Couchsurfing-Gastgebers verlasse, direkt in ein Slum hinein. Diese Durchmischung beobachte ich im gesamten Stadtgebiet.
Nach fünf Tagen habe ich genug Großstadtluft geschnuppert und mache mich – wie gefühlt alle Urlauber, die ich unterwegs treffe – auf den Weg nach Goa. Meine Idee, bei einem Zwischenstopp in Alt-Goa einen Eindruck vom portugiesischen Einfluss zu bekommen, fällt wegen der 7-stündigen Verspätung meines Zuges leider ins Wasser. Ich fahre weiter in den südlichen Teil Goas. Mein Ziel: Strand. Ich komme in dem Örtchen Palolem unter, das weniger für Ballermann, sondern mehr für seinen außerordentlich schönen Strand bekannt ist. Die Hoffnung, dort ungestört von Menschenmassen das Wellenrauschen genießen zu können muss ich dann doch im feinkörnigen Sandstrand begraben.
Zugegeben, nach 2,5 Tagen wird Strand, Sonne, Wärme und Fahrradfahren doch ein wenig langweilig und ich ziehe mit meinem Schneckenhaus weiter nach Kerala, einer Provinz, die durch ihre „Backwater“ bekannt ist. Zahlreiche Flüsse strömen aus den Western Ghats, den Gebirgen entlang der Westküste in das Arabische Meer. Bevor sie sich allerdings in das Arabische Meer entleeren, verteilen sie sich im flachen Küstengebiet in zahlreichen Kanälen und Seen. In Kerala gibt es mehrere (ich würde sagen drei) Backwater-Gebiete. Zunehmend beliebt bei Indern und ausländischen Touristen ist es, sich ein Hausboot zu mieten und damit die Backwater zu erkunden. Ein Hausboot kommt für mich aus mehreren Gründen nicht in Frage. Es gibt jedoch eine praktische Alternative: Auf den Backwatern findet regelmäßig Schiffslinienverkehr statt, um die Inselbewohner und Anrainer zu befördern. Der Lonely Planet für Indien hat einen kleinen Tipp parat: In Keralas nördlichstem, touristisch fast noch gar nicht erschlossenem Backwater „Valiyaparamba“ gibt es einen Fähranleger, der sehr nahe am Bahnhof des Örtchens Payyanur liegt.
Ich frage mich vom Bahnhof durch und erreiche das Wasser. Doch weit und breit ist kein Boot und keine Fähre zu sehen. Der Anleger sieht auch nicht so aus als ob hier in den letzten Monaten nennenswerter Schiffsverkehr stattgefunden hätte. Menschen, die ich fragen könnte, sind nicht da. Da sitze ich nun, genieße den Sonnenuntergang und warte. Die Landschaft erinnert mich sehr stark an die Wasserlandschaft Brandenburgs. Nach einiger Zeit kommt ein älteres Ehepaar den Sandweg hochgelaufen. Und nochmals wenig später manövriert ein alter Herr ein Ruderboot an den Strand. Ich versuche mich mit dem älteren Ehepaar zu verständigen und frage, wann die Fähre fährt. Doch sie verstehen mich nicht. Stattdessen geben sie mir per Handzeichen zu verstehen, dass ich mitkommen solle. Warum nicht? Ich habe eh keine sinnvolle Alternative vorbereitet. So paddeln wir hinüber auf die andere Seite, wobei ich nicht mal weiß, ob es sich beim anderen Ufer um eine Insel oder um Festland handelt. Auf der anderen Seite angekommen folge ich dem älteren Ehepaar. Irgendwohin werden sie mich schon bringen. Am Straßenrand treffen wir einen jüngeren Mann, der Englisch spricht. Nun habe ich Gelegenheit, meine Fragen loszuwerden. Und tatsächlich: Es fährt eine Fähre dorthin, wo ich hin will. Und zwar um 6.30 Uhr am nächsten Tag (Sonntag). Sonntag? Ob das stimmt? Doch was bleibt mir anderes übrig? So werde ich wieder in das Bötchen gesetzt (es war übrigens doch keine Insel) und werde wieder zurückgerudert, denn am Bahnhof befindet sich ein Guesthouse.
Als ich am nächsten Morgen um 6 Uhr aufstehe ist es noch dunkel. Ich laufe den Sandweg zum Anleger hinunter und treffe dabei auf einen Mann, der meint, er wäre Bootsmann. Siehe da, die Fähre fährt! Als wir zur Fähre kommen, wird der Motor gerade angemacht, die Jalousien hochgefaltet, die anderen Bootsmänner machen ihre Morgenwäsche. Scheinbar haben sie auf dem Boot geschlafen. Ich bin überrascht: Pünktlich um 6.30 Uhr legt die Fähre ab. Es wird spürbar heller, die Sonne deutet sich hinter den Hügeln an. Wir legen nach 15 Minuten das erste Mal an und holen an dieser Insel einen Vater ab, der seine Tochter mit dem Boot zur Schule begleitet. Auch bei den folgenden Halten steigen Schüler ein und aus, sowie ältere Frauen, die zum Markt wollen. Unterwegs passieren wir zusammengefallene Brücken und Fischer, die in der Morgensonne ihr Glück versuchen. Nach ca. 3 Stunden ist dieser kleine Ausflug in die fast einsame Wasserwelt Keralas zu Ende.
Bevor ich mich in die großen Backwatergebiete Südkeralas begebe, möchte ich die Western Ghats und die dortige Tierwelt ein wenig erkunden. Nur drei Stunden Fahrtzeit von der Küste in den Bergen befindet das Mudumalai Tiger Reserve. Auch wenn mir von vornherein klar ist, dass ich keinen Tiger zu Gesicht bekommen werde, hoffe ich, wenigstens einen wild lebenden Elefanten zu sichten. Doch auf der Safari lassen sich nur ein paar Rehe blicken. Ein Animal Reserve habe ich mir zudem etwas anders vorgestellt: Von wirklicher Einsamkeit ist man weit entfernt, irgendwie befindet sich doch im Umkreis von max. 10 Kilometern eine Siedlung, viel Landwirtschaft und mitten durch den Park führt eine viel befahrene Straße.
Da ich nun schon in den Bergen bin, erkunde ich noch die Teeplantagen um Ooty und fahre anschließend wieder an die Westküste und über Cochin in die südlichen Backwatergebiete. Auch hier tauche ich wieder mit Fähren des Linienverkehrs in die Backwaterlandschaft ein. So ganz wie ich es mir vorgestellt habe, funktioniert es aber diesmal nicht. Der Fahrplan, den mir das Internet ausgespuckt hat, scheint bei weitem nicht zu stimmen. Wie ich mit der Zeit herausfinde liegt das daran, dass entweder Kanäle wegen Brückenbauarbeiten gesperrt sind, manche Gebiete nun per Straßen erschlossen sind oder Fähren gänzlich ausfallen. Auch wenn mein Wasserausflug nun deutlich kürzer ist als ich es mir vorstellte, so traurig bin ich darüber nicht. Den Flair wie das nördliche Backwater haben die südlichen nicht. Hier ist ganz schön was los: Hausboot reiht sich an Hausboot, die Luft ist wegen der vielen Boote nicht besonders gut und das Wasser ist übersät von Unrat, insbesondere von Plastikflaschen und Styropor.
Auf meinem Weg weiter zur Südspitze passiere ich die Stadt, bei der man dreimal auf die Karte schauen muss, um den Ortsnamen korrekt zu lesen: Thiruvananthapuram oder kurz auch „Trivandrum“ genannt.
Mein Ortsnamengedächtnis hat anfangs auch etwas Schwierigkeiten mit dem südlichsten Ort Indiens – und dem am Südlichsten gelegenen, jemals von mir besuchten Ort: Kanyakumari. Erstaunlicherweise ist Kanyakumari keine Millionenstadt, wie man es von einer Stadt an solch einer strategisch wichtigen Position erwarten könnte, sondern nur ein Dorf mit nicht mal 25.000 Einwohnern, das sich fast vollständig dem Tourismus verschrieben hat. Die wenigsten Touristen jedoch haben eine Spiegelreflexkamera um den Hals hängen. Auffallend sind die Scharen an Männern schwarzem Mantel und orangenem Gürtel, die ohne Schuhe durch Indiens südlichste Stadt laufen: Aus ganz Indien kommen Hindus gepilgert, um im eindrucksvollen Kumari Amman Temple ihren Göttern zu danken. Wegen dieser Funktion als Wallfahrtsort strahlt Kanyakumari ein ganz besonderes Flair aus. Zudem gefällt mir folgende Vorstellung, die mir durch den Kopf schießt als ich am Küstenzipfel stehe: „Über“ mir sind jetzt fast alle der 1,25 Milliarden Inder.
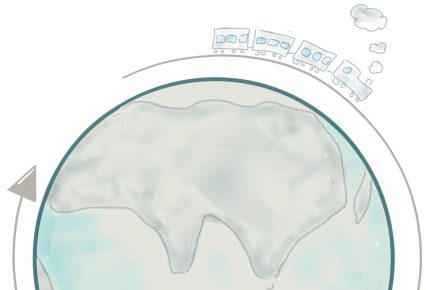

























Hallo Ferry,
unglaublich was Du alles erlebst und total interessant berichtet!
Alles Gute für die weitere Reise!
Peter Lehmann
Danke, Peter
Echt tolle Fotos!!!! Irre, was du alles erlebst!!! Was ist denn genau mit deinem Handy passiert?
Na ja, Handy war in der Hosentasche und bei der Wanderung entlang der Bucht war das Wasser plötzlich tiefer und zusätzlich kam auch noch ne Welle. Meine Schuld…
Ich bin beeindruckt von deinen Erlebnissen. Es ist ganz spannend deine Reiseberichte zu lesen. Ich freue mich schon auf den nächsten. Pass auf dich auf. Liebe Grüße aus dem ungemütlichen Norden Geli ☺
Mache ich, Geli 🙂